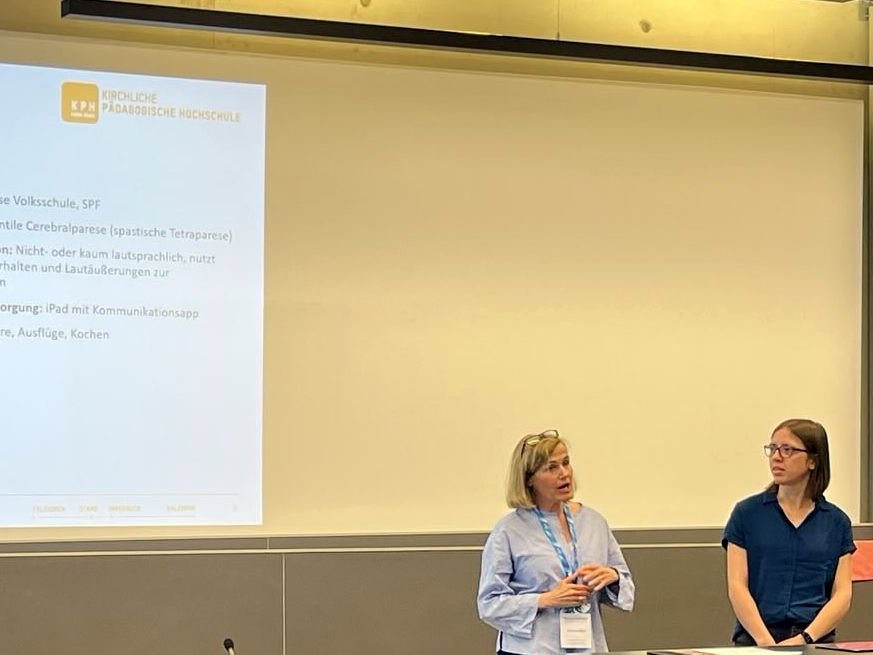Vom 9. bis 10. Mai fand zum bereits neunten Mal die Tagung Didattica e Inclusione scolastica – Inklusion im Bildungsbereich in Brixen statt. Rund 300 Wissenschaftler:innen, Lehrpersonen und Pädagog:innen nahmen an der zweisprachigen Tagung teil.
In einem vielseitigen Programm mit Kurzvorträgen präsentierten die teilnehmenden Expert:innen neue Forschungsprojekte und pädagogische Ansätze zu den Themen Bildungsgerechtigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie demokratische Bildung. Die KPH Edith Stein beteiligte sich mit drei inhaltlich vielfältigen Beiträgen:
Christa Hölzl & Katharina Orth:ICF-basierte Förderplanung: Wer oder was ist „förderbedürftig“?
ICF-basierte Förderpläne für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellen ein Instrument dar, um den individuellen Bildungs- und Unterstützungsbedarf systematisch zu erfassen. Ziel dieser Pläne ist es, das Potenzial der Kinder zu erkennen, den Lernprozess zu unterstützen und eine bestmögliche Teilhabe am Schulalltag zu gewährleisten (Pretis, 2022). Die Erstellung solcher Pläne ist jedoch mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden und birgt das Risiko der Stigmatisierung sowie der Reproduktion von Bildungsungleichheit (Moser Opitz et al., 2019). Zudem können individualisierte Förderangebote zur Koexistenz isolierter Einzelförderung führen, anstatt kooperatives Lernen zu ermöglichen (Wocken, 1998). Im Diskurs wird diskutiert, wie Förderpläne praxistauglich gestaltet werden können und ob der Fokus von der „Förderbedürftigkeit“ des Kindes auf die „Förderbedürftigkeit“ des inklusiven Unterrichts verlagert werden sollte.
Klaudia Zangerl & Simone Stefan:„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ – Über die Bedeutung von (auto)biografischer Textarbeit im Lehramtsstudium im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
Die Untersuchung basiert auf der Frage, welche Bedeutung Studierende der (auto)biografischen Textarbeit im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung beimessen. Erforscht wird, welches Potenzial die kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit jüdischen Lebensgeschichten hinsichtlich der Veränderung von Einstellungen, Werturteilen und Denkmodellen durch Perspektivenerweiterung in einer dialogischen Haltung (Buber, 1983) birgt. Im Rahmen der Lehrveranstaltung Pädagogische Professionalität wird den Studierenden der KPH Edith Stein (n = 35) ein Erzählraum in Form eines World-Cafés zu entsprechenden Fragestellungen geboten. Die Ergebnisse werden schriftlich auf Plakaten gesammelt, vorgestellt und anschließend mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2022) ausgewertet. Der Beitrag stellt zentrale Bedeutungsfaktoren dar und diskutiert das transformative Potenzial personaler Deutungsmuster und Weltbilder im Hinblick auf eine solidarische und verantwortungsbewusste Gesellschaft.
Mirjam Hoffmann (Freie Universität Berlin) & Nikolaus Janovsky:Teilhabemöglichkeiten im Jugendalter vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheiten
Soziale Ungleichheit kann als „sozial erzeugte Verteilung von Handlungsressourcen und Handlungsrestriktionen“ (Rössl, 2009, S. 37) verstanden werden – als gesellschaftlich (re-)produzierte Ungleichheit in Bezug auf materielle und immaterielle Güter. Im Jugendalter, in dem die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben maßgeblich durch verfügbare Ressourcen beeinflusst wird, spielen finanzielle und personelle Möglichkeiten eine entscheidende Rolle. Ausgehend vom Modell der Entwicklungsaufgaben nach Hurrelmann & Quenzel (2016) zeigt der Beitrag anhand von Daten von über 6.650 Jugendlichen aus der Euregio Tirol–Südtirol–Trentino (Janovsky & Resinger, 2022; EVTZ, 2022), welche Rolle die Ressourcenausstattung für Qualifikation, Bindung, Konsum und Partizipation spielt – und wie Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben dadurch gefördert oder verhindert werden. Der Beitrag beleuchtet zudem regionale Unterschiede innerhalb der Euregio.